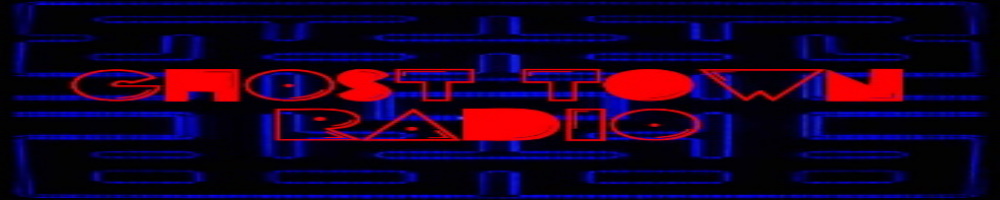Seit dem Durchbruch von KI ist es für Plattenkritiker schwieriger geworden, eine Band aus der Gegenwart historisch zu verorten. Denn: Trägt er so nicht gleich dazu bei, den Verdacht zu nähren, da ginge nicht alles mit rechten Dingen zu? Da könnte sich jemand mit Hilfe digitaler Zauberwürfel ein Soundkleid zurechtschneidern haben lassen, das recht authentisch nach Geschichte müffeln soll? Bei DeWolff aber lassen sich solche bösen Ahnungen sogleich zerstreuen: Denn als die Brüder Luka und Pablo van de Poel gemeinsam mit dem Hammond-Organisten Robin Piso ihr Trio in Geleen im Süden der Niederlande in der Provinz Limburg gründeten, vor 17 Jahren, da waren sie allesamt noch Teenager. Und KI allenfalls ein am Horizont dräuendes Versprechen. Sie standen damals unterm Einfluss von Tarantinos „Pulp Fiction“ – wie die Wahl ihres Bandnamens (Harvey Keitel spielt darin einen Ausputzer, genannt „The Wolf“) zeigt. Und waren offensichtlich von jenem Virus befallen, der sie auch heute noch, als gesettelte Dreißiger, fest und unausrottbar in der Hand hat. In ihrem Heimatland, sind sie Superstars, ihr letztes Album war auf Platz 1 der Charts platziert. Und mit ihrem neuen, am 6. Dezember 2024 erscheinenden Album „Muscle Shoals“, da legen sie ja selbst schon die Fährte, indem sie jenen kleinsten der heiligen Orte in den USA benennen, der wie Memphis oder Chicago, Detroit, New Orleans oder Nashville für einen spezifischen Sound steht. Das Foto auf dem Cover legt beredtes Zeugnis ab: Sie haben in den FAME- und vor allem in den „Muscle Shoals Sound“-Studios aufgenommen, also in Sheffield, Alabama – dort im Süden, wo der Tennessee-River das Treibgut von Rock, Blues, Country und Soul vor sich herschiebt, sodass es schließlich zu jenem Amalgam verschmilzt, das nach Percy Sledge und Aretha Franklin, nach den Allman Brothers und Swamp Dogg klingt.
Das Album beginnt hymnenhaft-euphorisch mit dem fantastischen „In Love“: Man wähnt sich auf einer Fahrt auf einem Highway durch die Prärie – und das alte Son Volt-Versprechen wird wahr, dass er irgendwo verborgen liegt, der „truer Sound“, auf der AM-Skala! Bei „Natural Woman“ darf man nicht den Fehler machen, sich an Carole Kings-Klassiker zu orientieren (den Aretha Franklin in einem Studio in Memphis so unvergleichlich gecovert hat) – sondern muss sich auf diesen ungewöhnlichen Reißer einlassen, dessen Leadgitarre sogleich Assoziationen wachruft, an Clapton’s „Strange Brew“. Und „Out on the Town“? Ja, da klingt als Quell der Inspiration „Whipping Post“ durch, mit dieser jaulenden Hammondorgel – vom 1969er Debüt der Allman Brothers. So ließe sich jetzt fortfahren, mit den restlichen zehn Songs – allein, die Qualität von „Muscel Shoals“, sie erschließt sich eben nicht nur aus historischen Vergleichen. Sondern Album #11 von DeWolff ist ein eigenständiges und selbstbewusstes Statement einer Band, die zu ihren Wurzeln steht und neue Triebe sprießen lässt. Wer mit oben Quellen etwas anzufangen weiß – oder Gegenwartsklassikern wie die „Black Keys“ zu seinen Favoriten zählt, sollte unbedingt dieses etwas roughere Album testen (wenn man deren im April erschienenes „Ohio Players“ als Vergleich heranzieht). Denn so lässt sich eine Band kennenlernen, die sich nicht nur darauf konzentriert, dem Echo aufeinanderschlagender Muschelschalen zu lauschen oder den nicht abreißen wollenden Fluss zu durchwaten. Sondern die ihn auch umzuleiten weiß, auf ihre eigenen Mühlen. Schön, wenn dieser Schlamm so reiche Frucht bringt! (Mascot Records) Peter Geiger
*****/*
******* = genial / ****** = phänomenal / ***** = optimal / **** = normal / *** = trivial / ** = banal / * = katastrophal