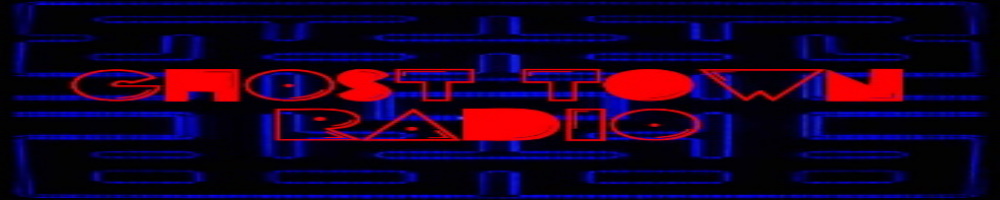Sind The Cure jemals wirklich jung gewesen? Selbst als Teenager in der englischen Punk-Ära hatte diese düster-elegante Band aus Crawley etwas verdächtig Erwachsenes an sich, die sich am liebsten an beschaulichen Samstagabenden zu Hause aufhielt, um tropfenden Wasserhähnen zu lauschen, während sie ihre Tränendrüsen fest zugeknöpft hielt. Vielleicht ist das der Grund, warum die Reife dieser Band so gut steht. Seit dem letzten Cure-Album sind 16 Jahre vergangen, seit ihrem letzten Hit drei Jahrzehnte. Und doch machen Robert Smith & Co. in einer Welt der dreistündigen Konzerte weiter, immer ihrer Muse folgend, frei von den ermüdenden Verpflichtungen, denen die nächsten jungen Talente ausgesetzt sind. Nun kehren sie endlich mit „Songs of a Lost World“ zurück, einem Album, das offensichtlich nicht daran interessiert ist, die Zeit nach seiner langen Reifung aufzuholen, und das sich in seinem eigenen gemächlichen Tempo bewegt.
Natürlich hatten The Cure in den vier Jahrzehnten ihres Bestehens auch Momente des Schwindels und der Freude. Aber „Songs of a Lost World“ hat keine herrlich albernen Liebeslieder wie „The Lovecats“; keine blutpumpenden Pop-Räusche wie „Just Like Heaven“; keine tonnenschweren psychedelischen Ausflüge wie „The Caterpillar“ und keinen Versuch, sich mit den über zwei Milliarden Menschen auseinanderzusetzen, die geboren wurden, seit die Band das letzte Mal ein Album veröffentlichte. Nichts hier – außer vielleicht dem riffigen Stolzieren von „Drone:Nodrone“, einem Song mit stählernem Gothic-Funk – steigert das Tempo über einen Spaziergang hinaus oder droht, die Temperatur über kalten Schweiß hinaus zu treiben. Stattdessen klingen The Cure auf ihrem 14. Studioalbum köstlich langsam, elegant müde und definitiv erwachsen.
„Songs of a Lost World“ bewegt sich vielleicht nicht schnell, aber das bedeutet nicht, dass es nirgendwo hingeht. „Alone“, der Eröffnungssong, ist ein Lehrstück dafür, wie Rockmusik in Würde altern kann. Reeves Gabrels‘ herrlich zerklüftete Gitarre zerrt an den Haaren von Jason Coopers Stadionschlagzeug, während ätherische Keyboardlinien sanft darüber wachen. Es ist eine epische „Thunderclouds-over-the-Mountaintop“-Produktion, die die gefühllose Energie der Jugend zugunsten einer nüchternen Reflexion meidet, verpackt in eine wunderbar nachdenkliche Akkordfolge. Wenn Robert Smith schließlich nach drei Minuten ans Mikrofon tritt und verkündet: „This is the end/Of every song that we sing“, fühlt sich das apokalyptisch richtig an, wie der seltsame Trost, wenn die schlimmste Angst wahr wird. Abgesehen vom dröhnenden, Nico-esken Intro von „Warsong“ gibt es kaum Momente, in denen sich The Cure musikalisch selbst übertreffen. Simon Gallups Basslinien sind einheitlich hart und tief und bringen denselben rauen Drive mit, den er seit 1979 immer wieder an den Tag legt; Coopers Schlagzeug hat die ruckelnde, von Toms geleitete Intensität von Lol Tolhursts Arbeit auf „Pornography“; und die geisterhaften Synthie-Melodien auf „Alone“ und „Endsong“ erinnern an die magische Melancholie von „All Cats Are Grey“ von „Faith“ aus dem Jahr 1981. Gabrels, der Neue in der Band, mit nur zwölf Jahren Dienstzeit, betritt am ehesten Neuland, obwohl sein Feedback und Fuzz auf „Warsong“ und das gequälte Wah-Wah auf „Drone:Nodrone“ den Hörer unweigerlich daran erinnern, wie viel die Shoegaze-Bands in erster Linie von The Cure geborgt haben.
Im Gegensatz zu den Rolling Stones im Jahr 2024 müssen Cure heute nicht mehr ihre Vitalität oder Relevanz unter Beweis stellen. Und warum sollten sie das auch? Manchmal hat man das Gefühl, dass wir alle irgendwann zu The Cure werden, da die ewigen – und anfangs frühzeitigen – Sorgen der Band über Sterblichkeit, Altern und Zweifel unweigerlich in unser Leben tropfen, wenn wir älter und gebrechlicher werden. Und wenn wir uns dem Cure beugen sollen, warum sollte sich dann das Cure uns beugen? Die Band hat sich ihren eigenen Sound geschaffen – gotisch, episch und doch seltsam minimalistisch – und sich das Recht verdient, dort zu bleiben. Songs of a Lost World fühlt sich dick und wichtig an, eine riesige Eiche von einem Album, das alles überragt, was es überblickt. Jedes Element zählt – jede gezupfte Basssaite, jedes rollende Schlagzeug, jeder wütende Gitarrenschlag oder jede sanfte Pianonote fühlt sich wichtig an. „Songs of a Lost World“ ist vielleicht kein großer Qualitätssprung im Vergleich zu den Post-„Wish“-Alben der Band bevorzugt. (Die Meinungen darüber gehen weit auseinander.) Aber es fühlt sich an wie eine Platte, deren Zeit gekommen ist, die eine konzentrierte Dosis Cure liefert und das Fett weglässt, das ihre späteren Alben verfolgte. Die acht Songs des Albums erzählen eindringlich vom Tod („I Can Never Say Goodbye“ handelt vom unerwarteten Ableben von Smiths älterem Bruder Richard), von Sterblichkeit (das wunderschöne „And Nothing Is Forever“) und von der Schwierigkeit, im gegenwärtigen Moment zu sein („All I Ever Am“). Smiths Stimme ist nach all den Jahren immer noch ein bemerkenswertes Instrument der Befreiung, und seine besten Couplets („And the birds, falling out of our skies/And the words, falling out of our minds,“ aus „Alone“) sind nach wie vor Wunderwerke der Ökonomie und des Handwerks. „Songs of a Lost World“ fühlt sich manchmal wie David Bowies eigene große Reflexion über die Sterblichkeit, „Blackstar“, an, obwohl The Cure nur wenige der stilistischen Risiken eingehen, die er eingegangen ist. Ähnlich wie in Bowies späteren Jahren hatte man oft das Gefühl, dass ein neues Cure-Album nie erscheinen würde, da der Schwung der Band durch die Unentschlossenheit der 2000er Jahre fatal abgewürgt wurde. Aber das vielleicht größte Kompliment, das man „Songs of a Lost World“ machen kann, ist, dass es sich bereits unausweichlich anfühlt, ein Werk von Weisheit und Anmut, das sich ganz natürlich von dem Moment an ausbreitet, als die Cure vor all den Jahren ihre Instrumente in einer örtlichen Kirchenhalle in die Hand nahmen. (Polydor) Ben Cardow
*****/*
******* = genial / ****** = phänomenal / ***** = optimal / **** = normal / *** = trivial / ** = banal / * = katastrophal